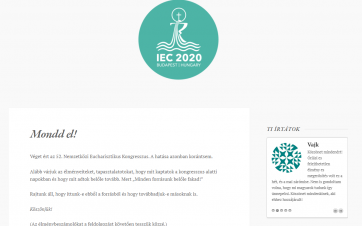222 Jahre - St. Josephs-Kirche

Nach der Befreiung von der Türkenherrschaft (1686) bestand das zuerst Untere Vorstadt, später Lerchenwiese-Vorstadt, genannte Gebiet hauptsächlich aus Ackerflächen und Gärten. Ab 1720 siedelten sich hier in größerer Zahl Deutsche und später Slowaken an, aber auch tschechische, mährische, polnische, rumänische und russinische Familien fanden hier eine neue Heimat. Die Bürger errichteten für sich heilige Stätten, wie den Kalvarienberg und einen Glockenturm.
Kleine Kirche einer großen Gemeinde
Zur Gründung einer eigenständigen Pfarrei kam es im Jahr 1777. Die erste Kirche war aus Holz gebaut und bot nur Platz für 380 Personen. Daher baten die Bürger Kaiser Joseph II. um den Bau einer größeren und prächtigeren Kirche, für die sie als Schutzpatron den heiligen Joseph, auch als Zeichen des Respekts für den Kaiser, gewählt haben.
Rasches Tempo
Mit dem Bau wurde 1788 nach den Plänen von József Tallher begonnen, aber bald stellte sich heraus, dass der Boden für ein so großes Gebäude ungeeignet war, so dass Fürstprimas József Batthyány es erreicht hat, die neue Kirche an der Stelle des ehemaligen Glockenturms zu errichten. Die Arbeiten begannen 1797, und der vereinfachte Bau schritt zügig voran. So hat man beispielsweise nicht mal auf die Fertigstellung des Turms und der Hauptfassade gewartet. Ende 1799 feierte schon der Pfarrer von Terézváros [Theresienstadt], Mihály Pfingstl, die Messe in der neuen Kirche.

Die gute Arbeit und die Zeit
Die schnelle Arbeit forderte jedoch ihren Tribut: Einige Wochen nach der Einweihung waren der Chor samt Orgel abgerissen, und bei der Inspektion vor Ort wurden auch Risse im Gewölbe festgestellt. Die Fertigstellung der Kirche begann schließlich 1810 mit einem zweitürmigen Entwurf. Diese Phase wurde 1814 abgeschlossen, aber die Türme wurden mit einem Walmdach anstelle eines Kupferhelms verschlossen.
Drei Jahrzehnte des Wartens
Für den verzierten Altar, der den schlichten Hochaltar ersetzte, sammelte man seit 1801, aber größere Spenden kamen erst nach 1825. Im Jahr 1835 wurde mit dem Bau des Hochaltars nach den Plänen des weltberühmten klassizistischen Architekten József Hild begonnen, der am Weihnachtstag 1837 eingeweiht wurde. Ein Jahr später kam das große Hochwasser von Pest.
Die Verwüstung durch die Flut
Das große Hochwasser von 1838 in Pest verschonte auch die Kirche nicht. Leider ist es nicht mehr möglich, das genaue Ausmaß der Schäden zu rekonstruieren, aber dem Inventar von 1844 zufolge muss der Schaden beträchtlich gewesen sein. Die Seitenaltäre des Heiligen Antonius von Padua, von Mariahilf und der Fischerzunft wurden so stark beschädigt, dass sie demontiert werden mussten. Die ersten größeren Renovierungsarbeiten fanden nach den 1850er Jahren statt und wurden ebenfalls von Hild geleitet.
Eingeschmolzene Glocken
Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich im Jahr 1867 wurde die Kirche nach einem Plan von 1889 im Stil des Neobarocks und der Neorenaissance umgebaut.
Von den fünf Glocken in den Türmen wurden drei während des Ersten Weltkriegs eingeschmolzen, aber dank den gemeinsamen Bemühungen der Bevölkerung konnten sie bis 1925 ersetzt werden.

1938 - prächtige Erneuerung
Für den Eucharistischen Kongress 1938 wurde eine weitere Renovierung durchgeführt, die Fresken der Kirche wurden gereinigt, die ornamentalen Verzierungen neu gestrichen, die Statuen und Seitenaltäre neu vergoldet und die Kanzel restauriert. Während des Zweiten Weltkriegs zog die Front buchstäblich durch die Kirche, die von der Sowjetarmee als Kaserne, Kochstelle und sogar als Toilette genutzt und fast vollständig geplündert wurde.
Zum Schweigen gezwungen
1983 nahm der Gründer der Gemeinschaft von Taizé, Roger Schütz, an einer stillen eucharistischen Anbetung in der Kirche teil, weil die kommunistischen Behörden ihm die Einreise nur gestatteten, wenn er in der Öffentlichkeit nicht sprach und nicht einmal Taizé-Gesänge durften gesungen werden. Im Jahr 1986 war die Heilige Mutter Teresa von Kalkutta zu Gast in der Kirche.
Ein neuer Anfang
Am Vorabend des politischen Wandels wurde die Gemeinschaft hier neu belebt. Die Reorganisation der klösterlichen Frauengemeinschaften begann hier mit Hilfe der Societas Sororum Socialium [Schwestern des Sozialdienstes]. Bereits seit 1990 unterrichten Religionslehrer*innen in den städtischen Schulen und Kindergärten. Die karitativen Aktivitäten wurden neu organisiert, und der Schwung hält seit Jahrzehnten an.
Spirituelles Zentrum
Die Kirche gilt auch als geistiges Zentrum der slowakischen Gemeinschaft in Budapest. In Józsefváros [Josefstadt] wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts regelmäßig Predigten in slowakischer Sprache gehalten, und einem Reiseführer von der Jahrhundertwende zufolge wurde an Sonn- und Feiertagen um halb sieben eine slowakische Predigt und um sieben Uhr eine slowakische Messe abgehalten. Für die geistliche Betreuung der Tschangos in Budapest hielt die Kirche darüber hinaus monatlich eine Messe in rumänischer Sprache.
IEK: Messe auf Slowakisch
Um die Jahrhundertwende wurde auch der Budapeštiansky katolicky delnícky kruh (Budapester Katholischer Arbeiterkreis), eine christlich-soziale Arbeitervereinigung, unter der Leitung des Pfarrers Endre Sándorfi gegründet. Sándorfi versuchte, die Mitglieder in religiöser und moralischer Hinsicht zu erziehen, auszubilden und zu unterrichten. Es ist daher durchaus verständlich, dass Metropolitanerzbischof S.E.R. Bernard Bober von Košice [Kaschau] beim Internationalen Eucharistischen Kongress am 8. September in der Pfarrkirche St. Josef die Heilige Messe in slowakischer Sprache zelebrieren wird.
In einer Familie
Der slowakische Hohepriester bemüht sich um einen lebendigen grenzüberschreitenden Dialog. Es war Erzbischof Bernard Bober, der die Reliquie der seligen Anna Kolesárová auf das Missionskreuz, das Symbol des Internationalen Eucharistischen Kongresses, legte. Anlässlich des 400. Todestages der Märtyrer von Kaschau, deren Reliquien ebenfalls das Kreuz schmücken, betonte der Erzbischof: „Keiner der drei heiligen Märtyrer von Kaschau war slowakischer Herkunft. Alle drei kamen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Márk Kőrösi wurde im heutigen Kroatien geboren, Menyhért Grodeczki in Polen und István Pongrácz stammte aus Siebenbürgen. Sie erlitten den Märtyrertod in Košice und wurden so zu „Kaschauern“. Ihr gemeinsamer Glaube machte sie zu Brüdern, was ein weiteres Beispiel für die Transnationalität der katholischen Kirche ist. Sie versammelt die Getauften zu einer Familie, unabhängig von Rasse und Nationalität“.
|
Die Kalvarienkapelle Die Geschichte des Gebäudes, das ursprünglich an der Stelle des heutigen Kalvarienplatzes stand, ist merkwürdig. Eine wohlhabende Frau namens Anna Maria Schwartz tötete ihren Ehemann während eines Streits, wofür sie zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Sie bat darum, ihre Strafe in einem Paulinerkloster zu verbüßen, und beschloss als Buße, mit ihrem Vermögen eine Kapelle bauen zu lassen. Die Arbeiten fanden zwischen 1746 und 1749 statt, und die Kalvarienkapelle wurde 1795 eingeweiht. Als Budapest Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Weltstadt wurde, wurde es im Zuge der Stadtplanung auf Initiative von Alajos Stróbl Stein für Stein an seinen heutigen Standort im Epreskert in Terézváros, auf den Campus der heutigen Ungarischen Akademie der bildenden Künste unter die Bajza-Straße 41, versetzt. |
Fotók és forrás: http://www.jozsefvaros.plebania.hu/, esztergomi-ersekseg.hu